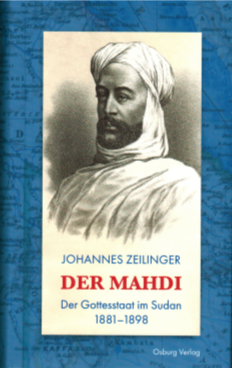
Der studierte Chirurg und langjährige Vorsitzende der Karl-May-Gesellschaft (2007 – 2019) Johannes Zeilinger aus Wolfratshausen hat in seiner Nebenbeschäftigung als Laienhistoriker nunmehr ein Buch zum Gottesstaat des Mahdi im Sudan (1881 – 1898) vorgelegt. Seinen Ausgangspunkt nimmt er selbstredend bei Karl May, der bekanntlich 1896 die Reiseerzählungstrilogie „Im Lande des Mahdi“ veröffentlichte. Im zweiten Band der Trilogie, der seit 1950 unter dem Titel „Der Mahdi“ erscheint, rettet Kara Ben Nemsi auf der Reise durch Kordofan den Fakir Muhammad Ahmad – der später als Anführer des Mahdi-Aufstands berühmt wird – vor einem Löwen.
Der Inhalt der neun Kapitel folgt im wesentlichen den chronologischen Abläufen des Mahdi-Aufstands bis zu seiner Niederschlagung. Es schließen sich ein Nachwort inklusive Danksagung sowie ein Personen- und Begriffsglossar an.
Den Einstieg im 1. Kapitel bildet eine zeitgenössische Eloge auf den Mahdi, verbunden mit Rückgriffen auf die Schriften Marl Mays über den Sudan. Das Buch endet im 9. Kapitel – etwas überraschend – mit einer Würdigung von Muhammad Achmad al-Mahdi als „eine der großen Gestalten des 19. Jahrhunderts“ (S. 361).
Wer nun jedoch einen im Stile Karl Mays verfassten spannenden, Land und Leute, Sitten wie Gebräuche beschreibenden Text aus der Feder von Zeilinger erwartet hat, wird relativ schnell eines anderen belehrt. Auf über 270 Textseiten (von insgesamt 361 Seiten) fließen Ströme von Blut, wird in großer Detailliertheit über Schlachten, Berge von Leichen, Grausamkeiten aller Art, Folter und Verstümmelungen; kurz: Mord und Totschlag berichtet. Die mehr oder weniger populäre Beschreibungen des Werdens des Mahdi-Gottes-Staats, seine religiösen Wurzeln sowie des gelebten Alltags findet sich auf relativ wenigen Seiten; insbesondere in den Kapiteln 3, 5 und 9, in denen es allerdings auch nicht an der Schilderung von Gefechten und Gräuel mangelt.
In den genannten Kapiteln beschreibt Zeilinger den Mahdi als einen freundlichen, gutmeinenden religiösen Fanatiker, der davon träumt, den Islam dadurch weltweit zu verbreiten, dass er einerseits mittels eines permanenten Jihad die Ungläubigen überall auslöscht und andererseits eine islamische Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit, Gleichheit und des Wohlstands für alle errichtet.
Die offensichtliche Schlagseite der Darstellung, die sich en detail und in eigenartiger Besessenheit auf militärische Operationen, die eingesetzten Waffen und die abscheulichen Grausamkeiten, die von den historischen Akteuren begangen wurden, konzentriert, entspringt zu einem großen Teil wohl der Quellenlage – die dem Text zugrunde liegenden Dokumente stammen vor allem aus den Britischen kolonial- wie militärhistorischen Archiven bzw. der Britischen Kolonial- und Militärgeschichtsschreibung. Vieles davon hätte (ohne Informationsverlust) allerdings auch wesentlich kompakter und vor allem summarisch-wertender dargestellt werden können.
Besonders ärgerlich ist die von Zeilinger vernachlässigte Quellenkritik. Deshalb sitzt er verschiedentlich wohl auch dem selbstberauschten Blick – „viel Feind, viel Ehr“ – der Geschichtsschreibung der Sieger auf. Dies zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Beschreibung der 317 Tage dauernden Belagerung Karthums 1884/85 durch das Heer des Mahdi. Hier übernimmt Zeilinger (S. 290) kommentarlos die Behauptung eines Priesters (Josef Ohrwalder), der die Gesamtzahl der Kämpfer des Mahdi (einschließlich deren Familien, Sklaven etc.) auf 200.000 bezifferte. Wenn man in Rechnung stellt, dass die landwirtschaftliche Produktivität der einheimischen Bevölkerung in der Region um Karthum damals – falls die dort häufigen Missernten ausblieben – bei etwa bei 7:1 lag – also sieben Erwachsene erzeugen ein hinreichend großes Mehrprodukt, um einen nichtarbeitenden Erwachsenen zu ernähren –, wäre zur Versorgung einer solchen Zahl von Kämpfern uns Tross die Arbeit von ca. eineinhalb Millionen Bauern erforderlich gewesen; von den logistischen Schwierigkeiten des Nahrungsmitteltransports und der Lagerung ganz zu schweigen. Damals lebten in der Großregion um Karthum allerdings nur zwischen 300.000 und 400.000 Menschen (einschließlich Kinder).
Da das Ende des Mahdi-Staates – in einem entsetzlichen Blutbad – bereits en detail Gegenstand des 2. Kapitels war, endet das Buch de facto mit dem plötzlichen Tod des Mahdi am 22. Juni 1885 infolge entweder einer Typhus- oder einer Meningitiserkrankung. Die folgenden 13 Jahre (die ca. 70 Prozent der zeitlichen Existenz des Gottesstaats aus machen!) werden schließlich auf den verbleibenden (nur) 28 Seiten (!) mit oberflächlicher Pauschalität summarisch umrissen. Detaillierter wird der Text auch hier – wie gewohnt – nur bei der Schilderung von Schlachten, Intrigen, Hinrichtungen und dergleichen.
Hier zeigt sich schließlich, dass das Buch nicht nur eine Schlagseite hin zu militärisch-gewaltförmigen Exzessen hat, sondern auch personenfixiert ist. Eine sozial-ökonomisch und soziologisch informierte Analyse des Mahdi-Staates als Gesellschaft findet faktisch nicht statt. Insofern ist der Untertitel des Buches irreführend.
Summa summarum, für all jene, die sich für eine speziellen Episode der britischen Kolonial- und Militärgeschichte en detail begeistern, mag dieses Buch interessant sein. Für diejenigen jedoch, die mehr über den Islam, seine Verzweigungen und historische Entwicklung und insbesondere den Mahdismus wissen wollen, ist es bestenfalls Sekundärliteratur.
Arndt Hopfmann
Das Buch:
Johannes Zeilinger: Der Mahdi. Der Gottesstaat im Sudan 1881 – 1898, Osburg Verlag, Hamburg 2025, 397 Seiten (29,00 €)